Als wir 2009 daran gingen, uns –zunächst für ein Jahr- in Paris niederzulassen, fanden wir eine Wohnung im Faubourg Saint-Antoine, einem uns bis dahin ganz unbekannten Viertel von Paris. Kein Wunder, denn in den meisten –jedenfalls älteren- Stadtführern ist es überhaupt nicht erwähnt, weist es doch keine besonderen Sehenswürdigkeiten auf, keine spektakulären Bauwerke, kein Museum oder andere Attraktionen. Und um den Ruf des Viertels stand es auch nicht immer zum Besten. So hat Mark Twain 1869 das Viertel als “Gegenstück (zum) prunkvollen Versailles mit seinen Schlössern, seinen Statuen, seinen Gärten und Springbrunnen” wie folgt beschrieben:
„Kleine, enge Straßen; schmutzige Kinder, die sie versperrten; schmierige, schlampige Frauen, die die Kinder einfingen und verprügelten; dreckige Höhlen in den Erdgeschossen, mit Lumpenhandlungen darin (…), weitere dreckige Höhlen, in denen ganze Garnituren von Kleidung aus zweiter und dritter Hand zu Preisen verkauft werden, die jeden Inhaber ruinieren würden, der sein Lager nicht zusammengestohlen hätte; … In diesen kleinen, krummen Straßen bringt man für sieben Dollar einen Mann um und wirft die Leiche in die Seine… In diesem ganzen Faubourg St. Antoine gehen Elend, Armut, Laster und Verbrechen Hand in Hand, und die Zeugnisse dafür starren einem von allen Seiten ins Gesicht. (zit. in: dtv Reise Textbuch Paris, 1990, S. 295/296).
Ganz anders das Wochenmagazin Le Point, das in seiner Ausgabe vom 28. Oktober 2010 das 11. Arrodissement, zu dem ein großer Teil des Faubourgs gehört, mit diesen Worten beschrieb:
„Avec ses nombreux îlots qui ont résisté à la vague haumssmannienne, le 11e est un arrondissement qui a du caractère. Parfois frondeur, souvent héroïque, toujours accueillant, il port sa mixité comme un étendard. … L’arrondissement le plus dense de la capitale, qui abrite 152 000 habitants, continue de séduire. Aux artisans et aux ouvriers qui ont fait sa réputation viennent désormais se joindre des artistes, des intellos et de jeunes couples avec leurs bambins » – und natürlich –wie man ergänzen muss- sogar deutsche Pensionäre! Wir haben jedenfalls in den sechs Jahren, die wir im Faubourg wohnten (von 2009 bis 2015) dieses Viertel immer besser kennen – und schätzen gelernt und es wurde zu unserer zweiten Heimat.
Im Gegensatz etwa zu den noblen Faubourgs St.Germain oder St. Honoré im Westen reiht sich am Faubourg St. Antoine kein grandioser Adelspalast an den anderen. Es gibt viele kleine Geschäfte, auch viele sog. Bazare mit billigen Sonderangeboten: Da haben wir zum Beispiel eine elektronische Küchenwaage für 3.50 € und eine Küchenmaschine für 19.80 € gekauft, auf die es sogar 3 Monate Garantie gab. Daneben gibt’s das chaotisch vollgeräumte Lädchen mit dem kleinen Chinesen, der das Messingschild (Mme et M. Jöckel) für unsere Wohnungstür hergestellt hat, dann den Blumenladen mit den Sträußen zu 3 € (5 Sträuße zu 10 €!), den nordafrikanischen Metzger, bei dem wir unser Lammfleisch kaufen, der schon in Gelnhausen und Hanau war und dessen Sohn, der ab und zu an der Kasse steht, sich freut, wenn man mit ihm deutsch redet, das er seit vier Jahren auf der Schule lernt. Und natürlich gibt es das sog. Internet-Café, in dem wir öfters waren, solange wir noch keinen Internet-Anschluss hatten: ein enger Raum vollgestopft mit Telefonkabinen und PCs, in dem meist ein babylonisches Sprachgewirr herrschte und in dem es lebhaft zuging wie auf einem Marktplatz. Vor allem wenn –wie öfters- die junge Russin da war, die mit ihrem lover ziemlich laut und schrill „skypte“.
Typisch für das Viertel sind aber vor allem die kleinen Durchgänge und Höfe, in denen „antike“ Möbel verkauft und manchmal auch noch hergestellt werden. Hier war nämlich früher das Viertel der Handwerker, die die Möbel für die Adelspaläste im Westen der Stadt, aber auch für den ganzen französischen Adel hergestellt haben, ihre Waren aber auch weiter nach Europa exportierten.
Dass der Faubourg-St-Antoine das Viertel der Kunst -Tischler wurde, hat natürlich auch historische Ursachen. Das ganze Viertel gehörte nämlich im Mittelalter zu dem Kloster Saint- Antoine- des- champs, und der Faubourg St-Antoine, an dem das Kloster lag, war ein Teil der wichtigen, breiten Einfallsstraße vom Westen in das Zentrum von Paris, die schon auf die Römer zurückgeht und auf der die Könige –bis hin zu Ludwig XIV- von ihrem Schloss in Vincennes in die Stadt einzogen oder sich bei wichtigen Anlässen vom Volk feiern ließen

Auf dem Merian-Stich von 1615 erkennt man im Vordergrund die Bastille und die „place Royalle“, also die heutige place des Vosges. Links im Hintergrund ist das Schloss von Vincennes mit seinen Türmen und der „sainte chapelle“ abgebildet. An der Straße nach Vincennes liegt -in der Mitte des Bildes- das Kloster S. Antoine des champs mit seinem sehr weitläufigen ummauerten Klosterbezirk. Der spitze Dachreiter auf der Vierung deutet darauf hin, dass es sich um ein zisterziensisches Kloster handeln muss.
In der Tat war St. Antoine des Champs ein nobles zisterziensisches Damenstift, das im Laufe der Jahrhunderte viele Schenkungen und Privilegien erhielt: Zwei davon waren besonders wichtig: 1131 erhielt das Kloster nämlich das Privileg, Schweine zu halten, was gleichzeitig im Stadtgebiet von Paris verboten wurde. Anlass war ein grotesker Unfall von Philipp, dem Lieblingssohn und Mitregenten Ludwigs VI: Im Alter von 15 Jahren ritt er mit seinen Gefolgsleuten in Paris entlang der Seine, als plötzlich ein Schwein seinem Pferd zwischen die Beine lief. Philipp wurde über den Kopf seines Pferdes geschleudert und zog sich so starke Verletzungen zu, dass er am Tag darauf verstarb, ohne vorher das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Das Kloster St. Antoine erhielt nun das Privileg der Schweinehaltung: Die Schweine des Klosters hatten sogar -in 12-er Trupps und mit Glocken um den Hals- Aufenthaltsrecht in den Straßen der Stadt. (1) Dieses Privileg mehrte erheblich den Wohlstand des Klosters.
Besonders folgenreich war dann ein weiteres Privileg, das das Kloster im Jahr 1471 unter der Regierung Ludwigs XI. erhielt: Damals wurden die im Bereich des Klosters angesiedelten Handwerker von den üblichen Zunftzwängen befreit, ein Privileg, das von Colbert 1657 erneuert wurde. So entstand im Faubourg Saint-Antoine gewissermaßen eine „marktwirtschaftliche Insel“. Während die „zünftigen“ Schreiner nur Eichenholz verwenden durften, konnten die Werkstätten im Faubourg St-Antoine auch andere Holzarten verwenden, vor allem die Edelhölzer, die ab dem 16. Jahrhundert aus den neu entdeckten Kontinenten nach Europa kamen. Die Kunsttischler des Viertels werden deshalb ja auch ébénistes genannt. Im Pariser Stadtmuseum (Hotel Carnavalet) sind auch zahlreiche Möbel aus dem 18. Jahrhundert ausgestellt, von denen ein wesentlicher Anteil sicherlich aus dem Faubourg St. Antoine stammt. Bei einem kleinen Rundgang habe ich –nur stichprobenartig- die Verwendung von 18 verschiedenen Holzarten festgestellt! Dazu kamen dann auch noch andere Materialien wie Bronze, der damals sehr modische japanische Lack, Marmor und verschiedene Farben und Stoffe, die bei der Möbelherstellung verwendet wurden. So entwickelte sich in diesem Viertel eine Vielfalt von kleinen Betrieben rund um die Möbelproduktion.

Hier ein Detail eines im Pariser Stadtmuseum musée Carnavalet ausgestellten Paravent aus dem Faubourg Saint-Antoine. Es handelt sich um eine mit Imitationslack (Vernis Martin) der Familie Martin hergestellte Arbeit mit chinesischen Motiven.
Eine besondere Anziehungskraft übte der Faubourg Saint-Antoine auch für deutsche Handwerker aus. „Sie brachten nach Paris Kenntnisse und Fertigkeiten, die sie in den oft beschränkten Verhältnissen ihrer Herkunftsstädt nicht sinnvoll einsetzen konnten und die in Frankreich nicht in vergleichbarer Weise beheimatet waren“, vor allem die Arbeit mit Furnieren. „Umgekehrt fanden sie in der französischen Metropole einen Markt, den es anderswo vergleichbar nicht gab, und sie profitierten von dem hohen Interesse, das die kulturell und gesellschaftlich führenden Kreise für handwerkliche Höchstleistungen zeigten.“ (Pallach)
Ein Beispiel ist der im Rheinland geborene Johann Franz Oeben. Er arbeitete zunächst in der Werkstadt eines französischen Kunsttischlers, machte sich dann aber im Faubourg Saint-Antoine selbstständig. Von Madame Pompadour, der Mätresse Ludwigs XV., erhielt er zahlreiche Aufträge.

Man kann davon ausgehen, dass der elegante kleine Nachttisch auf dem Portrait der Madame de Pompadour von Boucher (Alte Pinakothek München) von Oeben angefertigt wurde.
Oebens Schwester, die er gleich mit nach Paris gebracht hatte, heiratete einen andern deutschen Kunsttischler, Martin Carlin aus Freiburg im Breisgau, der viele Aufträge von Madame Du Barry und Marie Antoinette erhielt. Und als Oeben starb, heiratete seine Witwe einen anderen deutschstämmigen Ebenisten, nämlich Jean-Henri Riesener. Der allein hatte im Faubourg Saint-Antoine vor der Revolution 30 Werkstätten, um den Luxus-Bedarf des Adels zu befriedigen. Riesener verkörperte die „perfection de l’ébenesterie parisienne sous Louis XVI“. (Info-Text aus dem Musée Nissim Camondo). Er fertigte insgesamt 600 feinste Möbel für den königlichen Hof und war bevorzugter Lieferant von Marie Antoinette.
Und so kann Jean-Claude Bourgeois in seinem kleinen Führer durch den Faubourg Saint-Antoine feststellen, am Ende des 18. Jahrhunderts sei in den Werkstätten und auf den Straßen des Faubourgs ebenso flüssig deutsch wie französisch gesprochen worden. „Les Allemands“ waren ein Begriff : Unter diesem Stichwort notierte sich Ludwig XVI. Zahlungen von 2400 und 1200 livres f+r eine Kommode und einen Schreibsekretär in seinem privaten Ausgabenbuch. Auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammten viele der in dem Viertel arbeitenden Handwerker aus Deutschland. Und sie waren auch ein wesentlicher Bestandteil des revolutionären Potentials des Viertels, wie sich in den Revolutionen von 1830 und 1848 zeigte. (2)
Die meisten der von Oeben und Riesener angefertigten Möbel für den königlichen Hof wurden 1793/94 von den Revolutionären verkauft und sind heute in englischen und amerikanischen Museen ausgestellt. Immerhin existiert noch der berühmte Schreibtisch von Ludwig XV., der von Oeben begonnen und von Riesener vollendet wurde. Er ist heute im Schloss Versailles zu bewundern.

Seit 2021 gehört ein weiterer Sekretär aus der Gemeinschaftsproduktion von Oeben und Riesener mit wunderbaren Einlegearbeiten wieder zu dem Versailler Mobiliar.

Sekretär der dauphine Marie-Josèphe de Saxe, 1763-1765
Schöne Möbelstücke von Riesener gibt es auch im sehr empfehlenswerten Museum Nissim Camondo am Monceau-Park zu sehen. Unter anderem diese raffinierte Commode, deren Schubladen durch einen seitlich verschiebbaren bemalten Lamellen-Vorhang verdeckt sind.

Kommode von Jean-Henri Riesener
Eine weitere Riesener-Kommode ist seit Ende 2021 im neu eröffneten Hôtel de la Marine an der Place de la Concorde zu bewundern. Die gehörte zum ursprünglichen Mobiliar, das aber während der Französischen Revolution zum größten Teil zerstört wurde. 2021 tauchte aber eine Riesener-Kommode wieder auf und wurde von einem Mäzen für 1,2 Millionen Dollar (!) ersteigert, dem Hôtel übergeben und damit wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Die Heimat der Kommode
Insgesamt gab es im 18. Jahrhundert etwa 800 Werkstätten im Faubourg, die mit der Produktion von Luxus-Möbeln beschäftigt waren. Zum Ruhm und Erfolg des Viertels trugen auch neue Möbelstücke bei, die hier erfunden wurden wie die Credenz oder Anrichte und vor allem natürlich die Kommode. Erfunden wurde sie von André-Charles Boulle im Jahre 1662. Sie ersetzte die alte Holztruhe, weil sie wesentlich praktischer und bequemer –commode- war, wie Boulles Frau spontan ausrief, als ihr Mann ihr seine Erfindung präsentierte: Mit Hilfe der Schubladen konnte man leichter Ordnung halten als in einer Truhe, und auf der Kommode war auch noch Platz für Vasen, kleine Statuen und andere schöne Dinge nach dem Geschmack der Zeit. Und weil die Befreiung vom Zunftzwang nicht auf Franzosen beschränkt war, entwickelte das Viertel auch eine große Anziehungskraft auf unternehmungslustige und schöpferische Handwerker: Kunsttischler aus anderen Ländern wie Flandern, den Niederlanden und vor allem Deutschland: Doch zur revolutionären Geschichte des Faubourgs mehr im entsprechenden Folgebeitrag.
Dass gerade der Faubourg Saint- Antoine das Zentrum des Holzhandwerks wurde, beruht natürlich zunächst und vor allem auch auf seiner Lage in der Nähe der Seine-Kais, auf denen das die Seine herabgeflößte Holz gestapelt wurde. Im 16. Jahrhundert, als Paris, die größte damalige Stadt Europas, 300 000 Einwohner hatte, waren die Wälder in der Umgebung nicht mehr in der Lage, den Bedarf der Stadt an Holz zu decken. Holz wurde vor allem für die Kamine benötigt, aber auch für den Hausbau und für die Herstellung von Möbeln. Die dafür erforderlichen riesigen Mengen an Holz wurden deshalb aus den noch intakten Wäldern des Morvan über die Yonne und die Seine nach Paris geflößt. Zunächst wurden kleine „branches“, Flöße von 4 mal 4,5 m, zusammengebunden, dann, sobald die Breite und Tiefe des Flusses es erlaubten, „coupons“ von 4 branches und schließlich „parts“ aus 9 coupons. Ab Auxerre wurden dann ganze „trains des bois“ von 72 Metern Länge zusammengebunden und in 11 Tagen von 2 „flotteurs“ nach Paris geflößt. Dort wurden die „Holzzüge“ in der Nähe des Faubourg Saint -Antoine angelandet. Holz und Seile wurden verkauft, und die Flößer gingen zu Fuß nach Auxerre zurück, um von dort einen neuen Transport zu übernehmen. Pro Jahr waren das mehrere tausend solcher riesigen Holzzüge, die letzten im Jahr 1877. Da hatte die Eisenbahn das Flößen als Transportmittel ersetzt.
Zur Produktionspalette des Faubourgs gehörten auch die Tapeten, die mit speziell angefertigten Holzmodeln bedruckt wurden. Eine der größten europäischen Manufakturen für Tapeten (papier peint) war die königliche Manufaktur Reveillon, die in der Vorgeschichte der Französischen Revolution eine bedeutende Rolle spielte. (Dazu mehr im nachfolgenden Beitrag über den „revolutionären“ Faubourg Saint-Antoine). Darüber hinaus wurden hier auch Spiegel produziert. Im 16. Jahrhundert war deren Herstellung ein venezianisches Geheimnis und Monopol. Ludwig XIV. beauftragte aber 1665 im Zuge seiner merkantilistischen Politik seinen Finanzminister Colbert, eine königliche Spiegelglas-Manufaktur zu gründen mit dem Ziel, Frankreich von den venezianischen Importen unabhängig zu machen. Diese Manufaktur wurde im Faubourg St. Antoine, in der Rue Reuilly, angesiedelt. Sie erlebte ihre Blütezeit ab 1688, als in Frankreich ein neues Verfahren entwickelt wurde, das die Herstellung besserer und größerer Spiegel ermöglichte. Die königliche Manufaktur im Faubourg St-Antoine erhielt –auch um sie für bürgerliche Investoren interessanter und gewinnträchtiger zu machen- ein Monopol auf dieses Verfahren und dann vor allem den prestigeträchtigen Auftrag zur Ausstattung des Spiegelsaals im Schloss von Versailles. Die Vormacht der Venezianer in der Glas- und Spiegelproduktion war nun gebrochen. Im Jahr 1692 erhielt die königliche Spiegelmanufaktur den Namen einer Produktionsstätte bei Laon: St. Gobain – inzwischen eines der größten französischen Unternehmen, das immer noch –auch in Deutschland- führend in der Glasproduktion tätig ist. Von dem früheren Standort ist heute allerdings nichts mehr zu sehen, immerhin gibt es davor eine Erinnerungs-Tafel der Stadt Paris.
Noch 1955 war der Faubourg Saint-Antoine das größte Zentrum der französischen Möbelproduktion. Heute werden nur noch in wenigen der Höfe in unserem Viertel Möbel hergestellt bzw. wenigstens repariert, manche Möbelhersteller haben hier aber immerhin noch ihren Sitz oder einen Ausstellungsraum.
Ein schönes Beispiel ist (bzw war bis Ende 2018) das Maison Stroesser im Cour St-Nicolas zwischen der Avenue Ledru Rollin und der Rue St-Nicolas.

Gegründet wurde dieser Betrieb von einem elsässischen Handwerker, der nach dem deutsch-franzöischen Krieg 1870/1871 aus dem Elsass emigriert war, um nicht unter preußisch-deutscher Besatzung leben zu müssen.

Danach gehörte der Betrieb der Familie Lepennec, die -wie wir festgestellt haben- sogar unsere Nachbarn in der Rue Maillard sind. Bevor wir das entdeckten, war ich schon oft bei Spaziergängen mit Paris-Besuchern dort vorbeigegangen, und anfangs hatte ich gedacht, der am Eingang postierte Hund sei aus Porzellan. Er war aber aus Fleisch und Blut und hieß Dagobert. Die Firma Stroesser bot ein breites, hochwertiges Möbelsortiment an, das vom Patron nach Kundenwünschen entworfen und dann von auswärtigen Unternehmen produziert wurde.

Es gab aber auch noch eine alte sympathische Werkstatt im Hof, in der Möbel repariert wurden und neue Möbel den letzten Schliff und die gewünschte Politur erhielten.


Inzwischen (seit Anfang 2019) gibt es das Maison Stroesser und diese Werkstatt nicht mehr. Wieder ein Stück der alten Ebenisten-Tradition des Faubourg Saint-Antoine, die verschwunden ist.
So wie auch dieser alte Tischler, den ich vor Jahren in einem der Handwerkerhöfe des Viertels fotografiert habe:

Er stellte sich in einem an der Eingangstür befestigten Blatt als ébéniste, also als Kunsttischler vor, dazu als Hedonist -de pére en fils- und auch noch als Ataraxist- eine erstaunliche Bezeichnung bei einem Menschen, der kaum eine klassische Bildung erhalten hat: Die Kombination dieser Selbstetikettierungen verweist auf den griechischen Philosophen Epikur, für den dauerhafte Lust nur der erfahren kann, dessen Verlangen auf das Notwendigste beschränkt ist.

Das passt auch gut zu dem Eindruck dieser Werkstatt. Als ich das Foto machte, war der hedonistische Tischler allerdings bei einer wenig lustvollen Beschäftigung: Er schrieb gerade die Überweisung für einen Strafzettel wegen falschen Parkens…. Auch den alten Tischler gibt es aber inzwischen nicht mehr…
Wie lebendig und ausstrahlend diese Tradition gewesen ist, hat sich mir übrigens kürzlich (Mai 2018) wieder eindrucksvoll bestätigt: Ein Schweizer, der auf diesen Beitrag aufmerksam geworden war, hatte mich kontaktiert und mir von den Beziehungen seiner Familie zum Faubourg Saint-Antoine berichtet. Sein Großvater Oskar Bieder hatte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sogar zweimal bei Tischlern im Faubourg Saint-Antoine gearbeitet: Das erste Mal im Rahmen seiner Gesellenwanderung von 1882 bis 1885 bei dem Möbelhersteller G. Seuret, wie sein Wanderbuch ausweist.

Danach kam Oskar Bieder noch einmal zurück in den Faubourg Saint-Antoine, um von 1888 bis 1893 bei dem aus Böhmen stammenden Kunsttischler François (eigentlich Franz) Linke „seine technischen und gestalterischen Fähigkeiten der Möbelherstellung noch weiter zu verfeinern“. Linke war auf seiner Gesellenwanderung nach Paris gekommen und dort sesshaft geworden. In seinem florierenden Betrieb, der „seit der Weltausstellung von 1900 als die exklusivste Kunstschreinerei in Paris, wenn nicht in ganz Europa“ galt, beschäftigte er auch andere deutschsprachige Schreiner. Auf einem Foto von 1886 ist die Belegschaft zu sehen: Sie strahlt das Selbstbewusstsein und den Handwerkerstolz der ébénistes des Faubourg Saint-Antoine aus.

Das übertrug dann Oskar Bieder auf die Kunsttischlerei, die er nach seiner Rückkehr in die Schweiz gründete.
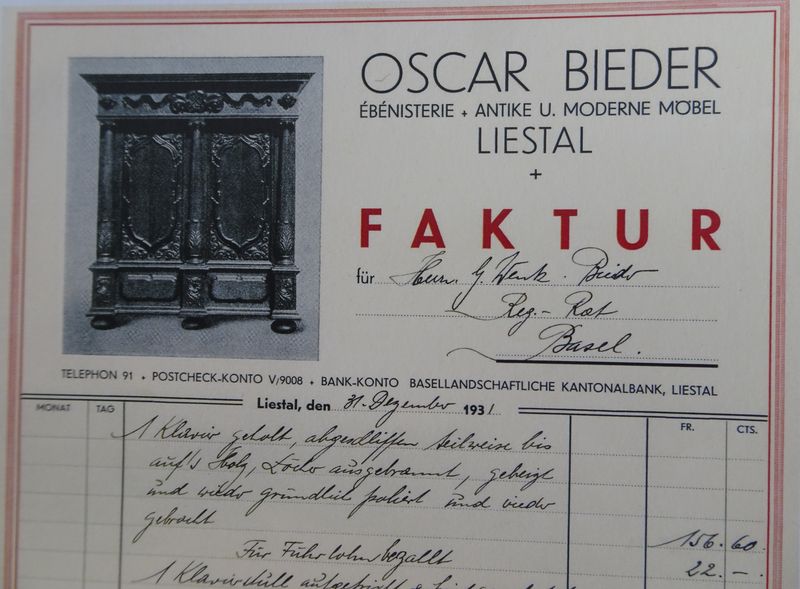
Sie firmierte unter dem dort ungebräuchlichen, aber programmatischen Namen Ébénisterie und wurde zur führenden Kunstschreinerei der Schweiz. Auch Hans Bieder, der Sohn und Nachfolger Oskar Bieders, verbrachte Lehrjahre in Paris, unter anderem -wie sein Vater- bei der Firma Linke im Faubourg Saint-Antoine. Ich hatte die wunderbare Gelegenheit, mit dem Enkel von Oskar Bieder und dem Neffen von Hans Bieder einen Spaziergang durch das Viertel zu machen, an dessen Ende er mir ein Buch über die Kunstschreinerei Bieder in Liestal schenkte (Liestal 2016), dem die vorstehenden Bilder entnommen sind. Die Firma Linke gibt es allerdings nicht mehr. Allerdings fanden wir in einem alten Verzeichnis der ébénistes des Viertels, das uns der Patron der Maison Stroesser zeigte, noch einen entsprechenden Hinweis…
Doch nach diesem Exkurs zurück bzw. weiter mit unserem Spaziergang durch den Faubourg Saint-Antoine. Im Cour St. Nicolas hat sich -gegenüber der Werkstatt der Maison Stroesser- inzwischen eine Fahrradmanufaktur eingerichtet. Als ich kürzlich mit Besuchern dort war, machte der Chef gerade über Skype ein Interview mit einer Zeitschrift in Dubai. Aber eine freundliche Dame hat uns etwas herumgeführt und die Finessen der hier hergestellten Fahrräder erläutert. Sie kosten dann allerdings auch zwischen 9000 und 20000 Euro! Abnehmer gibt es offenbar genug… Und dass die Felgen manchmal aus Holz sind, ist doch immerhin auch ein Anknüpfungspunkt an die handwerkliche Tradition des Faubourg Saint-Antoine.

Ein alter Handwerkerhof ist auch der Cour du Bel Air im Faubourg St. Antoine Nr.56, der glücklicherweise immer zugänglich ist.

Man sollte sich durch das Schild cour privé nicht abschrecken lassen und durch die Toreinfahrt in den begrünten Innenhof gehen. Dort wurde früher das von den Seine-Kais herangebrachte Holz gelagert, das für die Handwerker des Viertels bestimmt war. Heute parken da eher Autos, aber die entsprechenden Begrenzungen lassen sich noch gut erkennen.

Auf der linken Seite des Hofs fällt zwischen den Pflastersteinen ein großer Steinblock auf: Angeblich soll der den Musketieren, die in einer benachbarten Kaserne untergebracht waren, als Spieltisch gedient haben. In einem Büchlein über „Paris secret et insolite“ (Paris 2012) wird er deshalb auch als „pavé des Mousquetaires“ bezeichnet (S. 147). Legenden sind oft einfach zu schön, um nicht erzählt zu werden, auch wenn ihr Wahrheitsgehalt ungewiss ist…


Lohnend ist auch ein Blick in das schöne alte Treppenhaus G mit seiner unter Denkmalschutz stehenden Holztreppe – und nicht versäumen sollte man es auch, sich den hinteren zweiten Hof anzusehen: Da bekommt man einen Eindruck davon, was man aus solchen alten Gemäuern machen kann, wenn man Geschmack und genug Geld hat. Von dem Holzhandwerk, das hier heimisch war, ist heute nichts mehr zu sehen.
Dafür hatte sich in dem Hof (in der linken hinteren Ecke versteckt) ein nobler Couturier niedergelassen, der auf Bestellung und auf Maß sehr feine Damengarderoben vor allem für Kundinnen mit nordafrikanischem „Migrationshintergrund“ anfertigte. Man konnte ihm bei der Arbeit zusehen, zum Beispiel wenn er Pailletten auf einem Abendkleid befestigte, und wenn er nicht unter Zeitdruck war, zeigte er auch gerne Fotos von seinen Kreationen.

Bei meinem letzten Besuch in dem Hof war die Werkstatt allerdings leergeräumt- schade. Leider gab es keinen Hinweis, was aus dem Couturier geworden ist – vielleicht ist er ja in größere Räume umgezogen, denn nach seinen Angaben konnte er in mit seinem ganz speziellen Nischen-Angebot gut leben.
Hochspezialisierte Handwerksbetriebe gibt es im quartier auch in anderen Bereichen. Ein schönes Beispiel dafür ist ein kleiner unscheinbarer Lederhandwerks-Laden in der abgelegenen rue Titon, in der es wenig andere Geschäfte und keine „Laufkundschaft“ gibt. Mit ihm habe ich auf etwas kuriose Weise Bekanntschaft gemacht. Bei einem unserer Koffer war eine Naht aufgeplatzt. Ich bin also damit zu einem Schuster, der aber nicht über das erforderliche Werkzeug verfügte und mich an den Laden in der rue Titon verwies. Der Inhaber empfing mich sehr freundlich, sah sich den Schaden an und meinte dann, der Arbeitsaufwand sei zu groß, eine Reparatur lohne sich also nicht. Wenn ich aber wolle, könne ich mich in seine Werkstatt setzen, er würde mir die erforderlichen Werkzeuge geben und mich einweisen, sodass ich das selbst machen könne. So geschah es dann auch.

Bei der Arbeit erfuhr ich dann auch etwas, wie er mit einem so abgelegenen Laden überleben kann. Er erzählte mir, dass es sich um einen alteingesessenen Familienbetrieb handele, dass er über spezielle Werkzeuge und ein know-how verfüge, das es sonst kaum noch gäbe. Von großen Modehäusern erhalte er Aufträge für Sonderanfertigunngen für Modenschauen oder haute-couture- Kollektionen. Das werde gut bezahlt und eröffne ihm auch den Zugang zu weiteren Kunden.
Ein lange Zeit ziemlich heruntergekommener und zum Abriss bestimmter alter Handwerkerhof ist der Cour de l’Industrie in der Rue de Montreuil., ein einzigartiges Ensemble. Dort haben einige Handwerker und Künstler unter ziemlich desolaten Bedingungen überlebt. Aber inzwischen hat die Stadt Paris sich der Höfe- es sind insgesamt drei aufeinander folgende- angenommen, sie unter Denkmalschutz gestellt und mit großem Aufwand ein Sanierungsprogramm gestartet, das im Februar 2017 abgeschlossen wurde.

Das Ergebnis ist beeindruckend und zeigt, dass -zumindest mit öffentlicher Hilfe- auch „normale“ Handwerker eine Sanierung „überleben“ können.
Da, wo jetzt das neue weiße Gebäüde steht, war früher der Platz der Dampfmaschine, die die drei Höfe mit Strom versorgte. Jetzt sind dort Ateliers für Künstler entstanden.
Und nochmal zum Vergleich der vorherige Zustand:

und nachher:

Zum Teil sind die alten Handwerkerhöfe im Faubourg für die Bobos (bourgeois-bohème) edel herausgeputzt. Das ist ein Aspekt des „embourgeoisement“, dem das Viertel seit Jahren unterliegt. Ein Beispiel dafür ist der kürzlich renovierte „Cour de l’Etoile d’Or“ (Nr. 75) mit der schönen Sonnenuhr von 1757. Der ist natürlich mit einer Schließanlage von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Aber unter der Woche kann man im Allgemeinen das Hoftor öffnen, ohne den Digicode zu kennen.


Direkt gegenüber diesem Hexenhäuschen mit Kater (auf dem Tisch liegend) wurde im ersten Hof des Cour de l’Étoile d’Or kürzlich übrigens ein hochmodernes und pikfeines Wohnhaus mit einer Wand aus rostbraunem Metall gebaut – ein Kontrast, wie er für das Viertel immer typischer wird.
Und dahinter gibt es dann noch einen zweiten, breiteren Hof. Handwerker findet man dort allerdings nicht mehr, aber im Sommer kann man in der Mitte des Hofs sogar Tomaten und Kürbisse bewundern.


Und im alten Treppenhaus findet man noch einen Hinweis auf die guten alten Zeiten der Möbelherstellung.


Es lohnt sich auch, einen Blick in den ehemaligen Handwerkerhof nebenan zu werfen, den Cour des Shadoks. (No 71). Dieser frühere Handwerkerhof verdankt seinen Namen Jacques Rouxel, dem Schöpfer der Shadoks, der hier gewohnt hat.


Zu den kleinen Paradiesen der sogenannten „Bobos“ gehört auch der Cour Reuilly. Den kann man allerdings nur mit viel Glück betreten, wenn man von einem freundlichen Bewohner hereingelassen wird, oder zusammen mit einem professioneller Führer, der den Geheimcode kennt. Hinter einem unscheinbaren Tor öffnet sich eine ganz eigene Welt mit kleinen herausgeputzten Häusern, Weinranken, Edelkatzen….


Sehr malerisch ist auch der Innenhof der Nr. 33, schön begrünt, mit lauschigen, von der Außenwelt abgeschirmten Sitzecken.

Allerdings muss man auch da Glück haben, als „normal Sterblicher“ dort hereinzukommen.

Denen, die draußen vor der Tür bleiben, streckt der Straßenkünstler Gregos höhnisch die Zunge raus….
Sehr gut zu beobachten ist im Cour des Bourgignons die enge Nachbarschaft von Arbeit und Wohnen, wie sie im Faubourg üblich war: Im Erdgeschoss befinden sich die Werkstätten, darüber z.T. Lagerräume, während in den oberen Stockwerken die Arbeiter wohnten. Bis hin zur Industrialisierung dienten ja die Werkstätten meistens auch als Wohnräume, wurde aber Mitte des 19. Jahrhunderts wiurde die hier zu beobachtende Trennung von Napoleon III. vorgeschrieben. Allerdings -wie die meisten der von oben verordneten sozialen Verbesserungen- nicht aus reiner Menschenliebe, sondern um nach den Erfahrungen der Revolutionen von 1789, 1830 und 1848 die Arbeiter ruhig zu stellen und außerdem auch noch die teuren Maschinen zu schützen. Heute ist in den ehemaligen Werkstätten unter anderem eine Design-Ausstellungshalle angesiedelt. An die industrielle Vergangenheit erinnert noch der unter Denkmalschutz stehende Schornstein der Dampfmaschine.

Jedenfalls lohnt es sich sehr, die Straße Faubourg Saint-Antoine zwischen der Bastille und der métro – Station Faidherbe-Chalgny entlangzubummeln und soweit möglich etwas in die rechts und links gelegenen (ehemaligen) Handwerkerhöfe hineinzusehen. Auf einige der alten Handwerkerhöfe wird man auch durch das cour-Schild mit dem großen F, das für Faubourg steht, hingewiesen. Das sind allerdings eher diejenigen Höfe, in denen noch Handwerksbetriebe oder neue an Publikumsverkehr interessierte Boutiquen angesiedelt sind. Ein schönes Beispsiel ist die rue de Montreuil Nr. 33, wo der China-Lack- Spezialist Lee stolz darauf hinweist, dass er die renommierte École Boulle absolviert hat.

Erhalten haben sich vor allem kleine Geschäfte, in denen nachgemachte Möbel aller Stilrichtungen angeboten werden, wie etwas in der Passage du Chantier.

Wenn man mit offenen Augen durch das Viertel geht, entdeckt man auf Schritt und Tritt, dass man sich in dem ehemaligen Viertel des Holzhandwerks befindet.

Besonders nobel ist die ehemalige Niederlassung der Holzfirma Boutet aus Vichy in der Rue Faidherbe – im art nouveau-Stil dekoriert.

Inzwischen ist daraus ein 4-Sterne- Hotel geworden, in dem man luxuriös und stilecht im Faubourg Saint Antoine logieren kann. Kosten pro Nacht: 240 bis 490 Euro. (Stand Juni 2016)

Und es gibt auch noch einige kleine spezialisierte Läden, in denen alles Mögliche angeboten wird, was für die Herstellung, Reparatur und Erneuerung alter Möbel erforderlich ist. Zum Beispiel das Atelier Lecchi, das vor allem auf die Restaurierung von Lackarbeiten spezialisiert ist (Ecke Rue du Dahomey/Rue St Bernard). Die arg verwitterte passende Bemalung der Außenwände lässt allerdings Zweifel aufkommen, ob dieses schöne Geschäft noch eine Zukunft hat.

Das gilt auch für die grandiose Quinquaillerie Lejeune in der Rue du Faubourg Saint -Antoine schräg gegenüber der Fontaine de Montreuil.

Hier habe ich ein Ersatzteil für die „antiken“ Messing-Türgriffe in unserer Wohnung gefunden, das ich schon lange gesucht habe: 2,50 Euro! Aber einfach ist das Geschäft nicht, wie ich von den sympathischen Besitzern erfahren habe: Da die Wohnungen in Paris meist sehr klein und sehr teuer sind, reicht es bei der Einrichtung oft nur für Massenware à la Ikea. Dafür braucht man die wunderbaren Produkte von Lejeune eher nicht.

Die Tradition des Möbelhandwerks wird auch durch die École Boulle aufrecht erhalten, ein Lycée professionelle des métiers de l’ameublement. Einmal im Jahr öffnet es seine Pforten und zeigt etwas von der Ausbildung und ihren Resultaten.

Nicht versäumen sollte man es, zum Beispiel am Ende eines Spaziergangs durch den Faubourg Saint-Antoine einen Blick in den malerischen Cour Damoye an der Place de la Bastille zu werfen, der tagsüber zugänglich ist. Dort gab es früher eine außergewöhnliche kleine Kaffeerösterei, die von einer entzückenden alten Dame betrieben wurde.

Der ausgeschenkte Kaffee war gut und unschlagbar billig und in Anbetracht des wunderbaren Ambiente konnte man auch bezüglich der hygienischen Verhältnisse ein Auge zudrücken. Die alte Dame ist übrigens 2016 in den Ruhestand gegangen. Ein junger Mann hat aber ihre Nachfolge übernommen und das Lädchen im alten Stil renoviert. Man kann dort wieder selbst gerösteten Kaffee kaufen und auch gleich probieren.
Ein passender Ort für ein Mittagessen im Faubourg Saint-Antoine ist „La Cour du Faubourg“ in der Nr. 27/ 29 der rue du Faubourg Saint-Antoine in der Nähe der Bastille.

Das Restaurant liegt -zumindest teilweise- in einem überdachten Hof des Viertels.Und die Preise sind ausgesprochen zivil, wenn auch inzwischen ein wenig teurer als auf diesem Preisschild….

Anmerkungen
(1) http://www.paris-anecdote.fr/Cochons-privilegies.html
(2) „On retrouvera nombre de compagnons et artisans allemands à Paris : en 1830 puis en 1848, ils contribueront grandement à la réputation révolutionnaire des ouvriers du Faubourg Saint-Antoine.“ http://www.histoire-immigration.fr/des-dossiers-thematiques-sur-l-histoire-de-l-immigration/les-pionniers-allemands-1820
Zweiter Teil des Beitrags über den Faubourg Saint-Antoine:
Der Faubourg Saint-Antoine, das Viertel der Revolutionäre https://paris-blog.org/2016/04/06/der-faubourg-saint-antoine-teil-2-das-viertel-der-revolutionaere/
Spaziergang durch den Faubourg Saint-Antoine
Pour en savoir plus:
Bourgeois, Jean-Claude : A la découverte du Faubourg Saint-Antoine. Association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur du Paris historique. Paris 2010
Diwo, Jean: 249, Faubourg St. Antoine. Flammarion 2006
Diwo, Jean: Les Dames du Faubourg. Editions Denoël 1984
Hervier, Dominique et al.: Le faubourg St. Antoine. Cahier du patrimoine. 1998
Laborde, Marie Françoise : Architecture industrielle Paris et environs. Paris 1998
Maréchal, Sebastien: Le 12e arrondissement. Itinéraires d’histoire et d’architecture. Action Artistique de la Ville de Paris. 2000
Michel, Denis und Renou, Dominique: Le Guide du Promeneur. 11e arrondissement. Paris 1993
Ulrich-Christian Pallach, Deutsche Handwerker im Frankreich des 18. Jahrhunderts. In: Deutsche in Frankreich, Franzosen in Deutschland 1715-1789. Beiheft Francia Band 15, herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Paris, S. 89-102 https://perspectivia.net/servlets/MCRFileNodeServlet/ploneimport_derivate_00012512/document(25).pdf
Michel Pinçon und Monique Pinçon-Charlot: La (re)prise de la Bastille: L’embourgeoisement du faubourg Saint-Antoine. In: Paris. Quinze promenades sociologique. Petite Bibliothèque Payot. Paris 2013, S. 129f
Ulrich-Christian Pallach, Deutsche Handdwerker im Frank




Pingback: Die Manufacture des Gobelins: Politik und Kunst – Paris und Frankreich Blog
Pingback: Erinnerungstafeln zu der Zeit von 1939 bis 1945 in Paris/Enfants de Paris 1939-1945 – Paris und Frankreich Blog